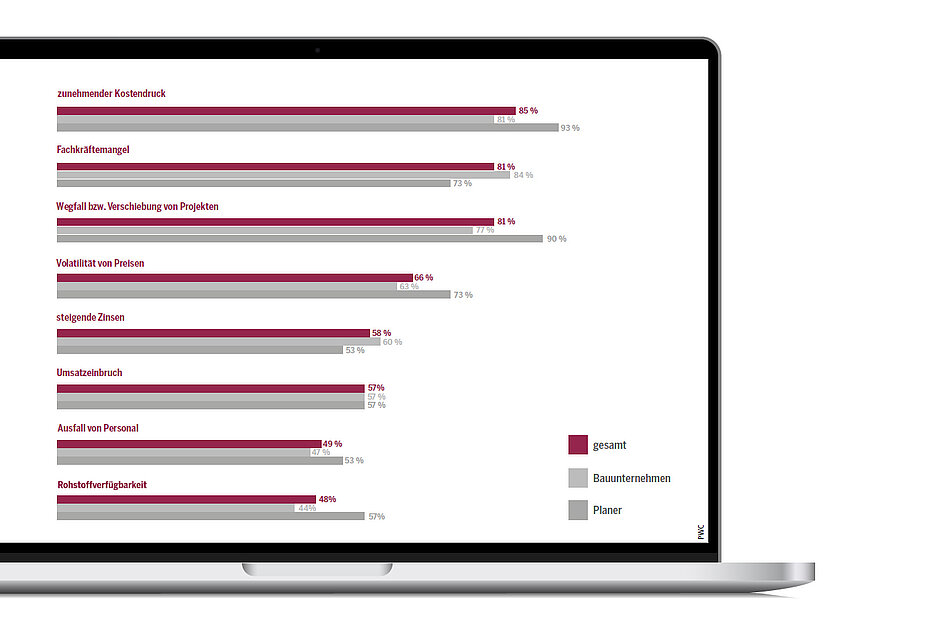Der notwendige digitale Aufbruch ist laut PwC nicht in Sicht, denn die Kluft zwischen Potenzial und Kompetenz wird immer größer. Hierbei könnte die digitale Transformation ein wesentlicher Baustein sein. 80 Prozent der Befragten sehen großes Potenzial in Simulation, Visualisierung und Cloud-Technologien. Trotz dieser optimistischen Einschätzung bleibt die Bewertung der eigenen digitalen Fähigkeiten ernüchternd. In einigen Technologiefeldern öffnet sich die Schere zwischen Potenzial und Kompetenz sogar immer mehr, wie der Jahresvergleich zeigt. Besonders deutlich wird dieses Auseinanderdriften bei Internet-of-Things-(IoT)-Lösungen auf der Baustelle. Auch bei BIM (Building Information Modeling) gibt es wenig Fortschritte. In den vergangenen Jahren hat diese Technologie weder eine Steigerung in ihrem Mehrwert erfahren, noch konnten die Unternehmen ihre Kompetenzen ausbauen.
KI-basierte Technologien gelten dahingegen als Hoffnungsträger: 66 Prozent der Befragten trauen der Technologie mittlerweile großes Potenzial zu – im Vorjahr lag der Wert noch bei 18 Prozent. Jedoch stellen der Fachkräftemangel und das fehlende digitale Know-how zentrale Herausforderungen für die Digitalisierung der Bauindustrie dar. 83 Prozent der Befragten bemängeln zudem, dass digitale Lösungen in Vergabeverfahren nicht ausreichend berücksichtigt werden, während 93 Prozent für einen Abbau bürokratischer Hürden (z. B. analoge Genehmigungsverfahren) plädieren.
ESG-Umsetzung stockt
Die vorliegende Studie zeigt darüber hinaus, dass 75 Prozent der befragten Unternehmen mittlerweile ESG-Ziele definiert haben. Jedoch wird der Fortschritt vor allem durch externe Vorgaben und den Druck von Auftraggebern angetrieben. Einsparpotenziale bei den Kosten sieht lediglich ein Drittel der Befragten als wichtigen Treiber und nur ein Viertel bezieht die Erfüllung von ESG-Vorgaben in die Vergütung ihrer Mitarbeitenden ein. Auch in diesem Kontext ist ein zentrales Hindernis für die Umsetzung das fehlende Know-how, da klare politische Ziele und stabile regulatorische Rahmenbedingungen fehlen, die den Unternehmen die notwendige Sicherheit geben.
Das Beispiel des CSRD-Reportings (Corporate Sustainability Reporting Directive) verdeutlicht die Problematik: Ein Drittel der Teilnehmenden bemängelt das Fehlen entsprechender Vorgaben. Dazu kommt, dass sich nach dem Ende der Ampel-Koalition und den Neuwahlen die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes auf unbestimmte Zeit verschiebt. »Für die Unternehmen ist das fatal. Denn für viele von ihnen wird die Einführung dieses Reportings dennoch irgendwann verpflichtend. Die nicht oder zu spät umgesetzten politischen Vorgaben erhöhen die Unsicherheit und vermindern die Akzeptanz«, so Dr. Martin Nicklis, Director im Bereich Wirtschaftsprüfung bei PwC Deutschland.s